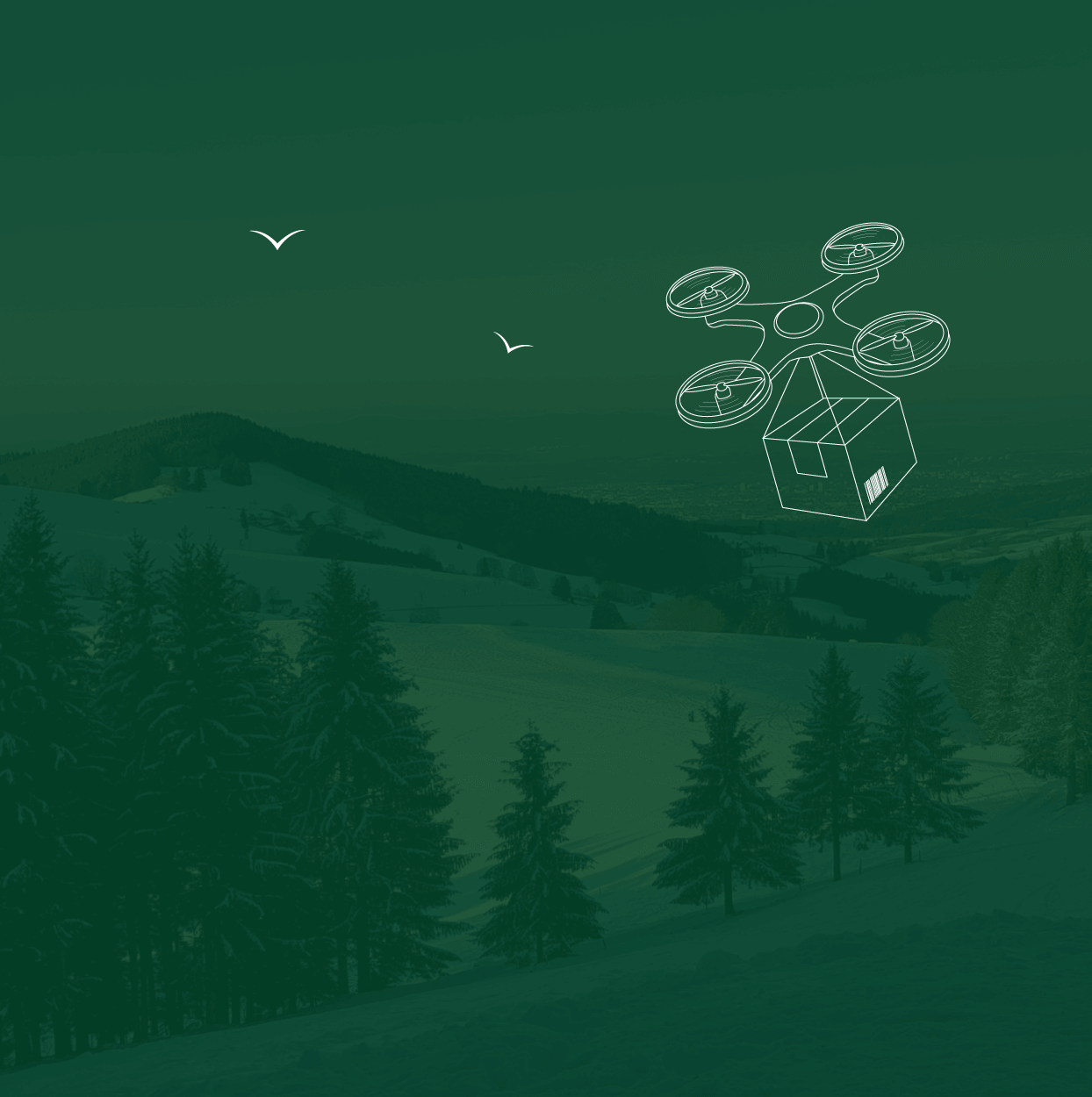Durch die Corona-Pandemie hat sich der anhaltende Boom der Versand- und Zulieferbranche nochmals verstärkt. Da sich dieser Trend in den kommenden Jahren kaum abschwächen wird, bedarf es kurz- bis langfristiger Lösungen, die sich mit Organisation und Infrastruktur befassen, um Straßen und Umwelt zu entlasten.
Ich wohne in einer kleinen beschaulichen Siedlung oberhalb der Stadt und erlebe täglich, wie sich sämtliche Paketdienste plus Briefdienstleister die Klinke in die Hand drücken, nachdem sie 400 Höhenmeter an Serpentinen hinter sich gebracht haben. Dazu gesellen sich Müllabfuhr und diverse Lieferservices. Dieses Phänomen hat mein Wohnort selbstverständlich nicht exklusiv. Deutschlandweit tummeln sich Zulieferer des Einzelhandels und Paketdienste zwischen den Dörfern, in den Vor- und Innenstädten. Auch ich bestelle meine Klamotten von Patagonia, Bücher oder Smoothiepulver gerne im Internet oder lasse mir bei Ebay-Kleinanzeigen erworbene Hemden per Paket zusenden und trage damit Verantwortung für das Problem – die Ethik des Konsums soll hier jedoch keine Rolle spielen. Der Wahnsinn besteht für mich weniger in der boomenden Versandbranche, sondern in den vielen unnötigen Kilometern und der damit verbundenen Umweltbelastung – die oftmals prekären und inakzeptablen Arbeitsbedingungen der Zulieferer und Angestellten im Versand und die Marktmacht einiger Anbieter sind ebenfalls ein Thema für sich.
Während Paketdienste und Zulieferverkehr weitestgehend auf Landstraßen und den innerstädtischen Verkehr beschränkt sind, verstopft der Fernverkehr die Autobahnen und belastet die Umwelt. Dieser setzt sich hauptsächlich aus vorgelagerten Lieferungen in Verteilerzentren, Waren für den Handel, Business-to-Business-Lieferungen sowie Transitverkehr zusammen.
Steigende Warentransporte und Emission
Dass es sich bei der steigenden Anzahl an Lieferungen und den vielen LKWs auf den Bundesstraßen und Autobahnen nicht um ein subjektives Empfinden handelt, belegt ein Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre. So stieg die Anzahl der Sendungen von Kurier-, Paket- und Expressdiensten zwischen 2009 und 2019 von 2.180 auf 3.650 Millionen. Dieser Trend wurde durch Corona im vergangenen Jahr nochmals verstärkt und führte phasenweise zu völlig überforderten Paketdienstleistern – und Rekordumsätzen von Versandhäusern.
Auch bei der oftmals heillosen Überfüllung von Bundesstraßen und Autobahnen durch den Güterverkehr ist das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht. Das Bundesverkehrsministerium geht von einer Zunahme des LKW-Güterverkehrs um mehr als 30 Prozent bis ins Jahr 2030 aus. Interessant ist, dass etwa 70 Prozent des Güterverkehrs auf LKW fallen, nur knapp 17 auf den Schienenverkehr. Der Anteil des Güterverkehrs auf der Schiene stagniert seit Jahren. Und das, obwohl die Umweltbelastung durch den Schienengüterverkehr erheblich geringer als durch LKWs ist. Der CO2-Ausstoß pro Tonnenkilometer ist bei einem LKW etwa 110-mal so hoch wie beim Schienengüterverkehr und der Energieverbrauch übersteigt den Güterverkehr zur Schiene um ein 19-faches. Der Ausbau der Schiene ist ein politisches Dauerthema, welches bei konsequenter Umsetzung eine erhebliche Entlastung des Fern- und Transitverkehrs bringen könnte. Optimistische Prognosen gehen von einem Ausbau des Schienennetzes innerhalb der nächsten 10-15 Jahren aus – realistische und pessimistische Schätzungen von mehr. Angesichts deutscher Umsetzungsprobleme im Bereich Infrastruktur, Missmanagement bei Großprojekten und Einfluss diverser Lobbygruppen ist letzteres zu befürchten.
Wenn der Paketdienst den Papiermüll mitnimmt
Die eingangs geschilderte Beobachtung mit zahlreichen Transportern bringt viele unnötige Kilometer und Leerfahrten mit sich. Im schlimmsten Fall fahren beispielsweise drei Paketdienste plus Post dieselbe Strecke, um dann jeweils ein Päckchen an eine entlegene Adresse zu liefern. Oder ein sowieso schon zugeparkter und von dichtem Verkehr geplagter Stadtteil wird von sämtlichen auf der Straße parkenden Transportern heimgesucht.
Es wäre sinnvoll, sowohl städtische als auch ländliche Gebiete unter den verschiedenen Dienstleistern aufzuteilen. In gemeinsamen Verteilerzentren könnte die Zusammenstellung der jeweiligen Gebietslieferungen erfolgen. Und eine Aufteilung nach Gebieten würde auch für die Lieferanten Vorteile mit sich bringen. Durch die Zuordnung würde sich die Paketdichte pro Quadratkilometer deutlich erhöhen und die Fahrstrecke minimieren. Diese Optimierung der Auslastung würde sich positiv auf den Umsatz und die Arbeitsbedingungen der Fahrer auswirken.
Eine weitere praktikable und leicht zu realisierende Idee, die zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt und Leerfahrten weitestgehend vermeidet, kommt aus Schweden. In Stockholm hat sich unter dem Namen „geliebte Stadt“ eine Initiative aus einem Lieferdienst, einem Abfallkonzern sowie einer Immobilienfirma und der Stadt zusammengeschlossen. Um umweltfreundlicher und wirtschaftlicher zu werden, wollte man Leerfahrten möglichst vermeiden. Denn während der Paketdienst voll ins Zentrum fuhr, um dann nach Auslieferung der Pakete leer zurück ins Verteilerzentrum zu fahren, war es bei der Müllabfuhr umgekehrt. Daher ging man dazu über, den trockenen Müll (Papier, Karton und Verpackungsmaterial) der Lieferdienstkunden mitzunehmen. Der Transport erfolgt ausschließlich mit elektrischen Fahrzeugen. Diese inzwischen auch in norwegischen Städten praktizierte Idee ließe sich mit Sicherheit auch hierzulande in der einen oder anderen Konstellation erfolgreich anwenden.
Entlastung von Autobahnen und Bundesstraßen
Dass die Autobahnen hierzulande durch zu viele Lastkraftwagen bevölkert werden ist offensichtlich. Aus klimatechnischer Sicht ist es zwar richtig, zukünftig auf Oberleitungs- und Elektrolastkraftwagen zu setzen, eine Entlastung für Straße und Anwohner ist dies jedoch nicht. Auch das immer wieder diskutierte Platooning ist nur eine Scheinlösung, da es lediglich für eine bessere Auslastung des Fernverkehrs und nicht für eine Entlastung von Straßen und Umwelt sorgt. Beim Platooning können Fahrzeuge durch eine computergestützte Steuerung mit sehr geringem Abstand hintereinander herfahren. Durch den Windschatteneffekt kommt es dadurch zu einer Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.
Wie bereits erwähnt ist der CO2-Ausstoß pro Tonnenkilometer eines LKWs erheblich höher, als der eines Güterzuges. Deshalb sollte der Güterverkehr auf der Straße, auch wenn er elektrifiziert wird, erheblich reduziert werden. Dies könnte man erreichen, wenn Metropol- und Ballungsräume sowie wichtige Umschlagplätze des Ex- und Imports über reine Güterverbindungen verknüpfen würden. Diese könnten sowohl als reine Gütertrassen für den Schienenverkehr als auch als fortschrittlichere Technologien wie Hyperloop oder Schwebetechnik umgesetzt werden.
Eine Idee, welche häufiger genannt wird und weniger aufwendig plus relativ kostengünstig umzusetzen ist, sind die oben erwähnten Verteilerzentren. Diese sollen außerhalb von Städten und Metropolregionen entstehen und vom Fernverkehr beliefert werden. Hier erfolgt idealerweise eine Zusammenstellung der angelieferten Waren nach Kunden und Gebiet sowie die Auslieferung mit kleineren Transportern – im besten Fall mit elektrobetriebenen. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung des Verkehrsaufkommens und damit der CO2-Belastung.
Investitionen in die Zukunft. Jetzt!
Erst kürzlich ließ die Bundesregierung auf Nachfrage verlauten, dass derzeit keine Investitionen in die Entwicklung des Hochgeschwindigkeitssystem Hyperloop geplant seien. Dabei bewegen sich Kapseln, welche mit Personen oder Waren bestückt werden können, annähernd mit Schallgeschwindigkeit in einer fast luftleeren Röhre auf einem Luftkissen. Bei ausgereifter Technologie und entsprechend großer, vielleicht sogar europaweiter Investition wäre es eine spannende Geschichte, ein dichtes Netz von Röhren zwischen Ballungsräumen und über Ländergrenzen hinweg zu bauen.
Eine weitere interessante, günstigere und weitaus leichter umsetzbare Lösung für den innerstädtischen und kurzstreckigen Transport stellen autonom fahrende Paletten oder Plattformen, auch Skateboards genannt dar. Diese elektrisch betriebenen Vehikel können, je nach Bedarf und austauschbarem Aufsatz, der Personen- oder Warenbeförderung dienen. Berücksichtigt man die Tatsachen, dass die Mehrheit der Fahrzeuge im Schnitt nur eine Stunde am Tag bewegt wird und sowohl Personen- als auch Gütertransporte selten unter voller Auslastung der Ladekapazität unterwegs sind, macht die Nutzung autonomer Transportsystem nach dem Sharing-Prinzip Sinn. Ein derartiges System könnte durch eine intelligente und vernetzte Computersteuerung eine optimale Auslastung erreichen und damit die gefahrenen Kilometer und die Belastung von Umwelt und Umgebung erheblich reduzieren. Neben dem Schweizer Unternehmen Rinspeed befassen sich auch Automobilgiganten wie Daimler oder Toyota mit dieser Idee.
Neben praktischen und kurz- sowie mittelfristig umsetzbaren Lösungen bedarf es auch einer gewissen Weitsicht und Innovationsfreude, um umwelt- und lebensfreundliche Technologien zu schaffen.Längst keine Zukunftsmusik ist die Auslieferung von Paketen per Logistikdrohne. Diese kleinen Fluggeräte mit einer Tragkraft von etwa 3 kg werden und wurden bereits von einigen Unternehmen wie Amazon, DHL, der Schweizerischen Post und DPD getestet. Auch wenn es sich dabei um eine wahrgewordene Zukunftsvision handelt, ist doch fraglich, inwiefern sich die Lösung in Zukunft durchsetzen wird. Denn neben rechtlichen Fragen und der (noch) geringen Tragkraft, wäre der großflächige und massenhafte Einsatz sicher befremdlich. Man stelle sich das morgendliche Ausschwärmen tausender kleiner Paketdrohnen in Berlin-Mitte oder der Heidelberger Altstadt vor.
Dieser Beitrag ist lediglich ein Hinweis darauf, dass Verkehrsprobleme oftmals mit einfachen Lösungen umsetzbar sind und lediglich an der Festgefahrenheit der beteiligten Akteure scheitern. Es fehlt von seitens der Politik an Vorgaben oder Anreizen für die Unternehmen. Noch gravierender ist die Passivität der Politik bezüglich langfristiger Lösungen. Die in vielen Bereichen wie etwa dem Netzausbau oder der Agrarwirtschaft herrschenden Stagnation zeigt sich auch im Bereich der Güterinfrastruktur. Es ist ein grundlegendes Problem der deutschen Politik, dass Investitionen in langfristige Projekte aufgrund des herrschenden Dauerwahlkampfs nicht sonderlich populär sind und immer wieder aufgeschoben werden. Doch Bereitschaft zu Investitionen und der Mut zu neuen Technologien sind unabdingbar, wenn Klimaziele erreicht werden sollen – und Deutschland technologisch in der oberen Liga mitspielen will.
zurück